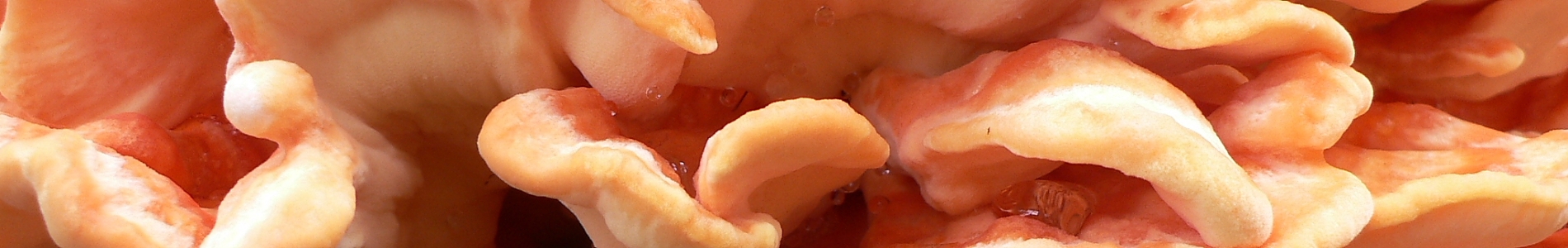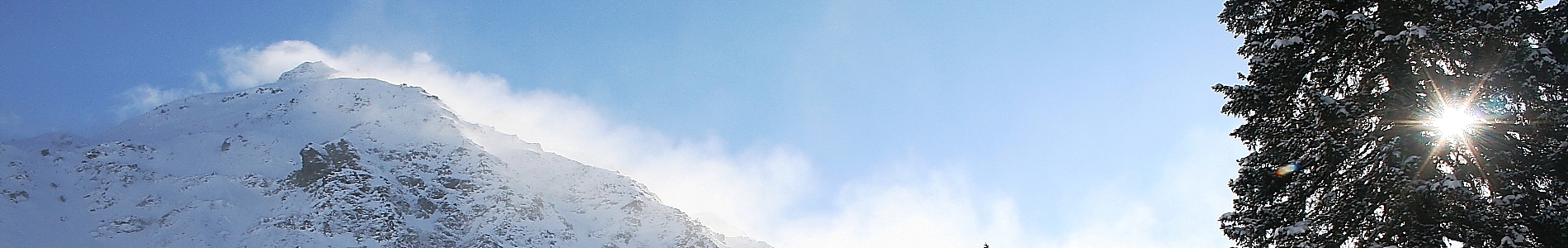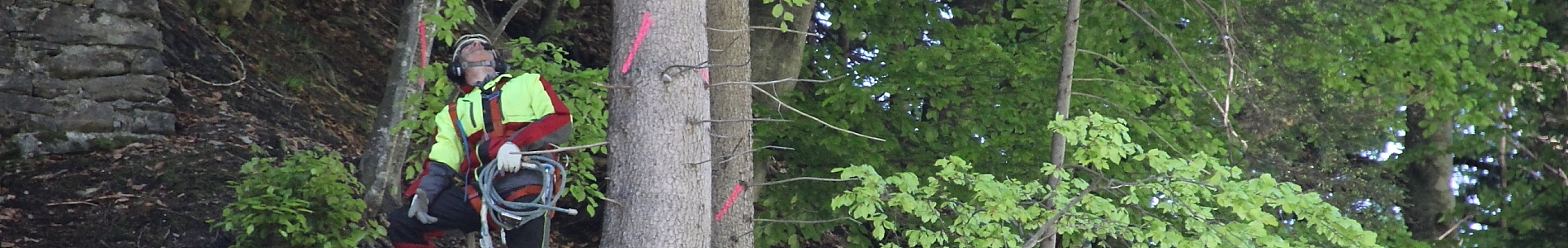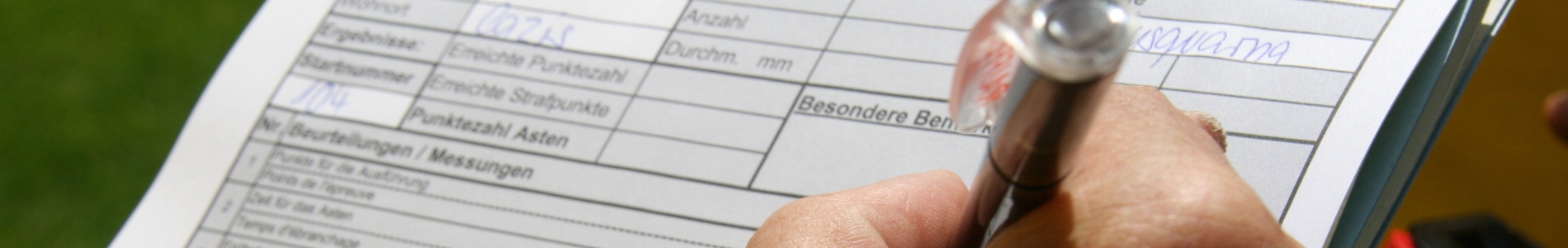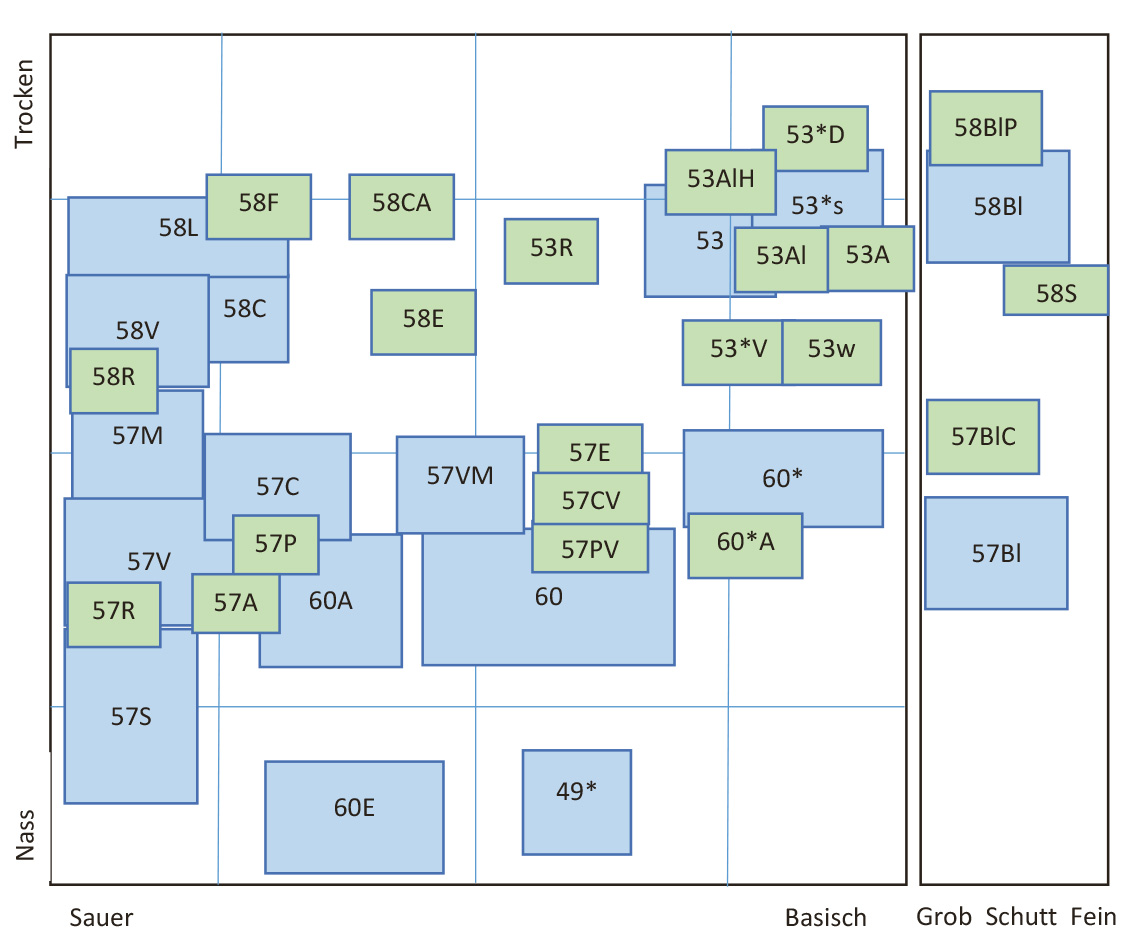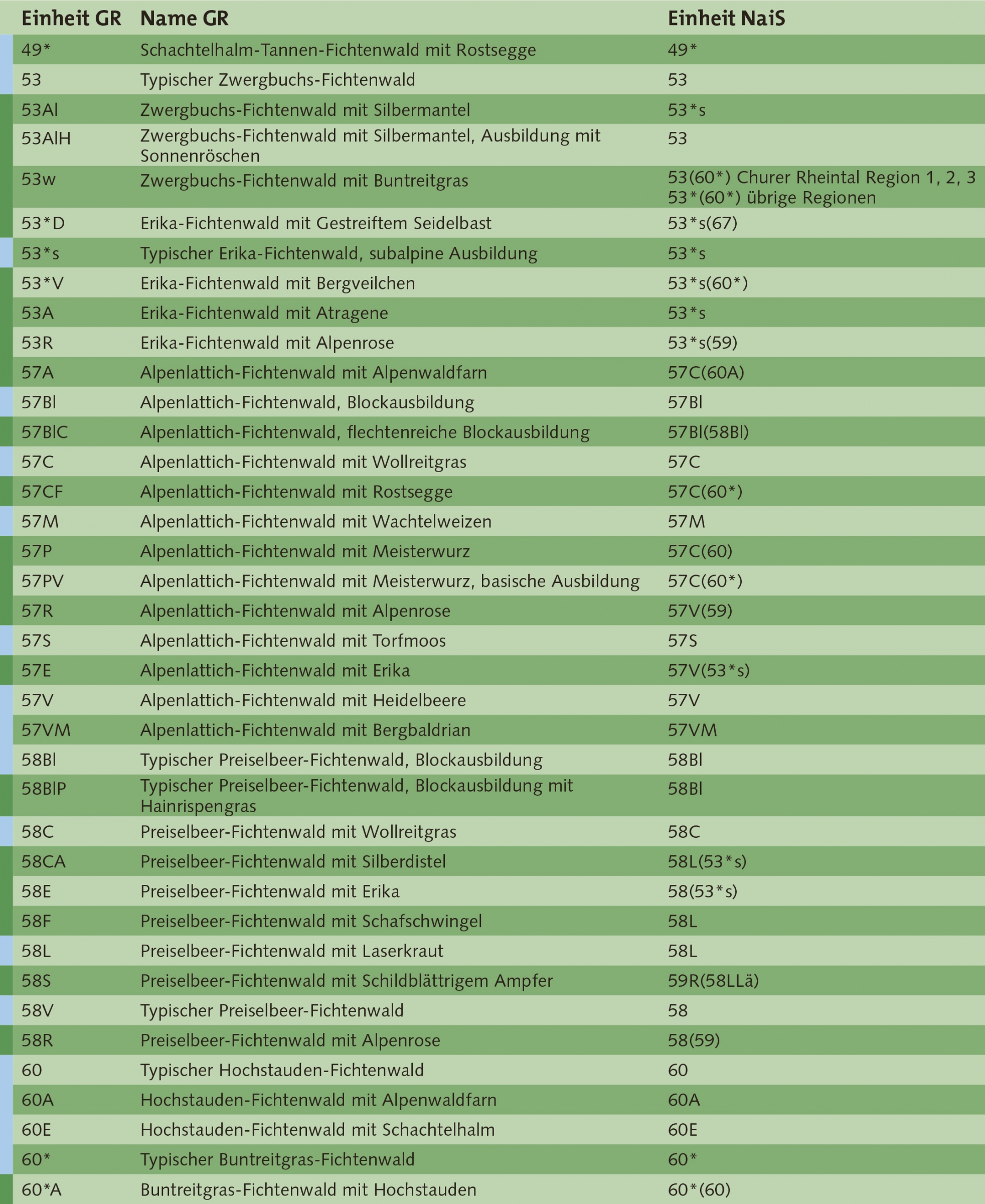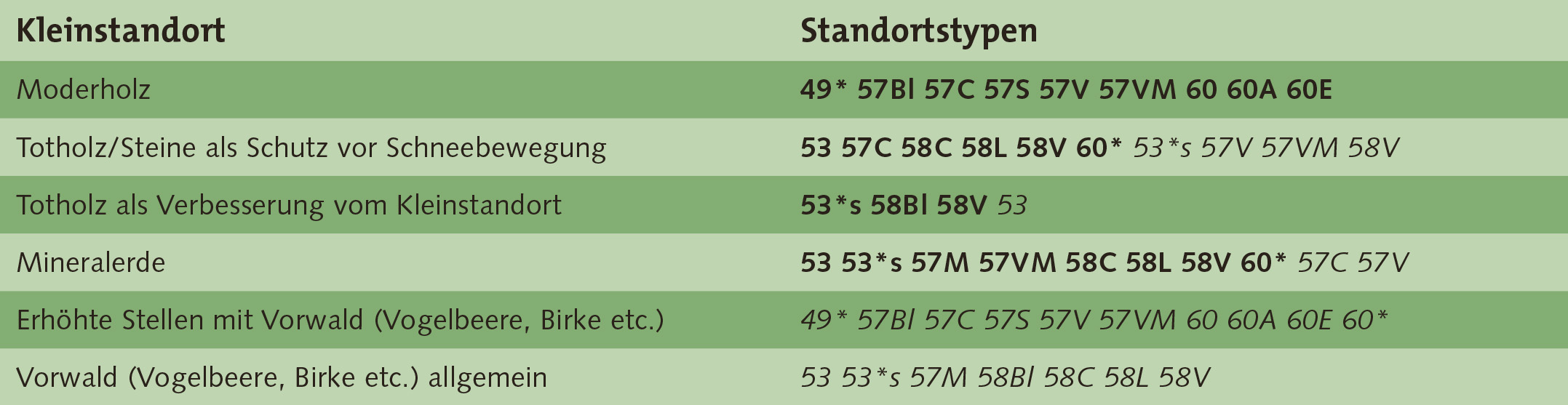Literaturverzeichnis
Quellenangaben zu Artikel " Komplette Überarbeitung der Waldstandort-Hinweiskarte Graubünden"
(Bündner Wald, Ausgabe Dezember 2020, S. 14-18)
Ott, E., Frehner, M., Frey, H. U., and Lüscher, P. (1997): Gebirgsnadelwälder. Ein praxisorientierter Leitfaden für eine standortgerechte Waldbehandlung, Haupt, Bern, Stuttgart, Wien.
Frehner, M., Wasser, B., and Schwitter, R. (2009): Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald. Wegleitung für Pflegemassnahmen in Wäldern mit Schutzfunktion, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL).
Huber, B., Zischg, A., Burnand, J., Frehner, M., Carraro, G. (2015a): Mit welchen Klimaparametern kann man Grenzen plausibel erklären, die in NaiS (Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald) verwendet werden um Ökogramme auszuwählen? Schlussbericht des Projektes im Forschungsprogramm "Wald und Klimawandel" des Bundesamtes für Umwelt BAFU, Bern und der Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf, 2015.
Huber, B., Zischg, A., Frehner, M., Carraro, G., Burnand, J. (2015b): Neu entwickelte Klimakarten für den Wald im Klimawandel, Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 166, 432–434, doi:10.3188/szf.2015.0432, 2015.
Ingenieure Bart AG (2006): SilvaProtect Modellierung Waldgesellschaften. St. Gallen.
Ingenieure Bart AG (2011): Kurzbericht Standortshinweiskarte Graubünden. St. Gallen.
Frey H.-U., Bichsel M. & Preiswerk T., 1998-2004: Waldgesellschaften und Waldstandorte Graubündens. Teilregionen 1 - 8. Hrsg. Amt für Wald Graubünden, Chur, in 8 sep. Ringordnern.
Frey H.-U., Frehner M., Burnand J., Carraro G., Rutishauser U. (in Vorbereitung): Zur Entstehung der NaiS-Standortstypen. Artikel SZF.
Zischg, A. P., Gubelmann, P., Frehner, M., Huber, B. (2019): High Resolution Maps of Climatological Parameters for Analyzing the Impacts of Climatic Changes on Swiss Forests, Forests, 10, 617, doi:10.3390/f10080617.
Quellenangaben zu Artikel "Kartierung der Waldstandortstypen auf den Probeflächen des LFI"
(Bündner Wald, Ausgabe Dezember 2020, S. 19-23)
ARGE Frehner M., Dionea SA und IWA – Wald und Landschaft AG, 2020: NaiS-LFI – Zuordnung der LFI-Stichprobenpunkte zu Waldgesellschaften. Erläuternder Schlussbericht. Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU, 68 S. Download auf Bafu-Webpage.
Frehner M., Wasser B., Schwitter R., 2005/2009: Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald – Wegleitung für Pflegemassnahmnen in Wäldern mit Schutzfunktion. Bern, Buwal. Ordner mit Ergänzungen 2009., Vollzug Umwelt. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern, 564 S.
Frey H.U., Bichsel M., Preiswerk Th., 1998 ff: Waldgesellschaften und Waldstandorte Graubündens. 8 Bd. Amt für Wald GR
Quellenangaben zu Artikel " Laubwälder der Bündner Südtäler"
(Bündner Wald, Ausgabe Dezember 2020, S. 24-27)
ARGE FREHNER M., DIONEA SA UND IWA – WALD UND LANDSCHAFT AG, 2020: NaiS-LFI – Zuordnung der LFI-Stichprobenpunkte zu Waldgesellschaften. Erläuternder Schlussbericht. Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU, 68 S. Download auf BAFU-Webpage. https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/umgang-mit-naturgefahren/naturgefahren--massnahmen/naturgefahren--biologische-massnahmen.html
CARRARO G. und PRON, S., 2013: Le tipologie forestali del Canton Ticino e loro tendenze evolutive (Locarno, Dionea SA; Bellinzona, Sezione forestale cantonale).
FREY H.-U., BICHSEL M. & PREISWERK T., 1998 - 2004: Waldgesellschaften und Waldstandorte Graubündens. Teilregionen 1 - 8. Hrsg. Amt für Wald Graubünden, Chur, in 8 sep. Ringordnern.
Quellenangaben zu Artikel " Bodensäure und Zink-Gehalte in Böden des Kantons Graubünden "
(Bündner Wald, Ausgabe Dezember 2020, S. 28-31)
AfU (Amt für Umweltschutz Graubünden), 1997: Langfristiges Bodenbeobachtungsnetz des Kantons Graubünden. Bericht über die Auswertung der Erstbeprobung 1989-1994.
Blaser, P., Walthert, L., Zimmermann, S., Graf Pannatier, E., Luster, J., 2008: Classification schemes for the acidity, base saturation, and acidification status of forest soils in Switzerland. J. Plant Nutr. Soil Sci. 171: 163-170.
Schwertmann, U., Süsser, P., Nätscher, L., 1987: Proton buffer compounds in soils. Z. Pflanzenernähr. Bodenkd. 150: 174-178.
VBBo, 1998: Verordnung über Belastungen des Bodens. SR 814.12 vom 1. Juli 1998 (Stand am 12. April 2016).
Zimmermann, S., 2017a: Säurestatus und Versauerungszustand von Waldböden im Kanton Graubünden. Bericht zu Handen der Abteilung Natur und Landschaft im Amt für Natur und Umwelt, Kanton Graubünden. Eidg. Forschungsanst. WSL, 57 S.
Zimmermann, S., 2017b: Säurestatus und Versauerungszustand der 51 LBN-Standorte (langfristiges Bodenmessnetz) im Kanton Graubünden. Bericht zu Handen der Abteilung Natur und Landschaft im Amt für Natur und Umwelt, Kanton Graubünden. Eidg. Forschungsanst. WSL, 16 S.
Quellenangaben zu Artikel " Sensitive Standorte und Bestände in Graubünden "
(Bündner Wald, Ausgabe Dezember 2020, S. 34-36)
Frehner M. & Huber B. Mit Beiträgen von Gubelmann P. (Teil 1 und 3), Zürcher-Gasser N. (Teil 4 und 5), Zimmermann N.E. (Teil 3), Braun S. (Teil 2), Scherler M. (Teil 2), Zischg A. (Teil 1), Burnand J. (Teil 1), Carraro G. (Teil 1), Bugmann H. (Teil 3), Psomas A. (Teil 3), (2019): Schlussbericht des Projektes «Adaptierte Ökogramme» im Forschungsprogramm «Wald und Klimawandel»: Übersicht über die Teilberichte. Sargans, Forstingenieurbüro Frehner und Chur, Abenis AG.
Quellenangaben zu Artikel " Eine App für die Baumartenwahl im Klimawandel "
(Bündner Wald, Ausgabe Dezember 2020, S. 37-39)
Allgaier Leuch, B., Streit, K., Brang, P. 2017. Der Schweizer Wald im Klimawandel: Welche Entwicklungen kommen auf uns zu? Merkbl. Prax. 59. 12 S.
Frehner, M., Wasser, B., Schwitter, R. 2005/09. Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald. Wegleitung für Pflegemassnahmen in Wäldern mit Schutzfunktion. Bern, Bundesamt für Umwelt.
Frehner, M., Brang, P., Kaufmann, G., & Küchli, C. 2018. Standortkundliche Grundlagen für die Waldbewirtschaftung im Klimawandel. WSL Berichte 66. Birmensdorf: Eidg. Forschungsanstalt WSL.
Quellenangaben zu Artikel " Walddauerbeobachtung in Graubünden"
(Bündner Wald, Ausgabe Dezember 2020, S. 42-47)
Braun, S., Remund, J. und Rihm, B. (2015). Indikatoren zur Schätzung des Trockenheitsrisikos in Buchen- und Fichtenwäldern. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 166, 361-371.
Braun, S., Schindler, C. und Rihm, B. (2017). Growth trends of beech and Norway spruce in Switzerland: the role of nitrogen deposition, ozone, mineral nutrition and climate. Science of the Total Environment 599-600, 637-646.
Braun, S., Hopf, S. E. und de Witte, L. C. (2018). Wie geht es unserem Wald? 34 Jahre Jahre Walddauerbeobachtung. Institut für Angewandte Pflanzenbiologie, Schönenbuch
Braun, S., Schindler, C. und Rihm, B. (2020). Foliar Nutrient Concentrations of European Beech in Switzerland: Relations With Nitrogen Deposition, Ozone, Climate and Soil Chemistry. Frontiers in Forests and Global Change 3, 33.
Flückiger, W. und Braun, S. (1995). Revitalization of an alpine protective forest by fertilization. Plant and Soil 168-169, 481-488.
Flückiger, W. und Braun, S. (2009). Wie geht es unserem Wald? Bericht 3. Institut für Angewandte Pflanzenbiologie, Schönenbuch
Göttlein, A. (2015). Grenzwertbereiche für die ernährungsdiagostische Einwertung der Hauptbaumarten Fichte, Kiefer, Eiche und Buche. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 186, 110-116.
MeteoSchweiz (2018). Hitze und Trockenheit im Sommerhalbjahr 2018 - eine klimatologische Übersicht. Fachbericht MeteoSchweiz 272, 36 S., Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie.
Rihm, B. und Achermann, B. (2016). Critical Loads of nitrogen and their exceedances, Swiss contribution to the effects-oriented work programme under the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution (UNECE). 78 S., Berne, Federal Office for the Environment (FOEN).
Schulla, J. (2013). Model Description WaSIM (Water balance Simulation Model). http://www.wasim.ch/de/products/wasim_description.htm, Zurich
Quellenangaben zu Artikel "Standörtliche Variabilität von subalpinen Fichtenwäldern"
(Bündner Wald, Ausgabe Dezember 2020, S. 53-57 )
ARGE FREHNER M., DIONEA SA UND IWA – WALD UND LANDSCHAFT AG, 2020: NaiS-LFI – Zuordnung der LFI-Stichprobenpunkte zu Waldgesellschaften. Erläuternder Schlussbericht. Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU, 68 S. Download auf BAFU-Webpage. https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/umgang-mit-naturgefahren/naturgefahren--massnahmen/naturgefahren--biologische-massnahmen.html
FREHNER et al. (2005): Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald. Wegleitung für Pflegemassnahmen in Wäldern mit Schutzfunktion, Vollzug Umwelt. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern, 564 S.
FREY H.-U., BICHSEL M. & PREISWERK T., 1998 - 2004: Waldgesellschaften und Waldstandorte Graubündens. Teilregionen 1 - 8. Hrsg. Amt für Wald Graubünden, Chur, in 8 sep. Ringordnern